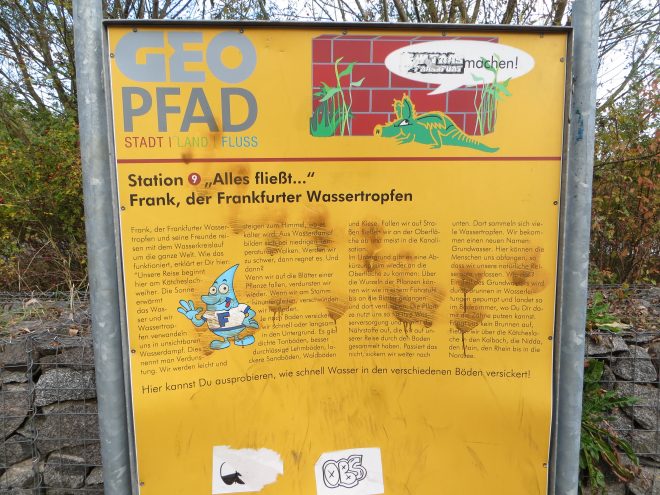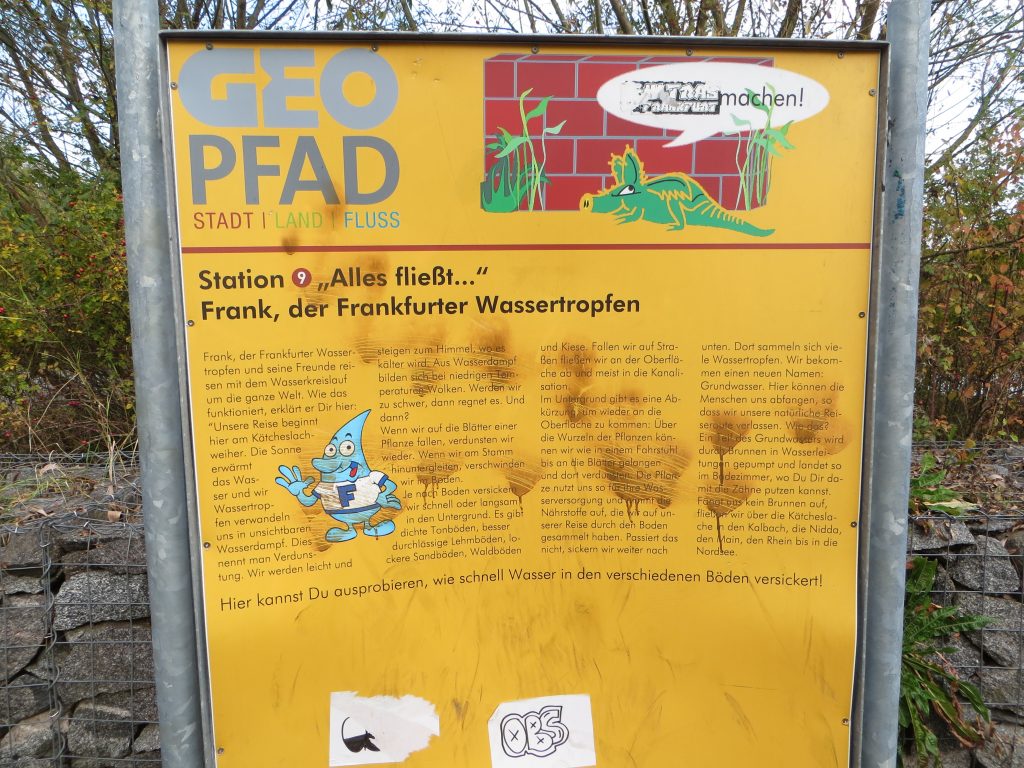Es war ein routinemäßiger Elternabend in der Kita Zauberberg Mitte/Ende Juni, als der Regionalvertreter des Kita-Trägers BVZ mitteilte, dass die Goethe Universität sich entschieden habe, diese Einrichtung zum 31.08.2024 zu schließen.
Begründet wurde die Schließung damit, dass die Einrichtung irgendwann würde schließen müssen, weil sie dem geplanten zweiten Bauabschnitt des Chemie-Neubaus im Wege stehen wird, wenn er denn mal kommt – und ein geordneter Übergang besser früher als überstürzt erfolgen solle. Die Kita hat Betreuungsplätze für 30 Kinder und ist derzeit voll besetzt.
Herkunft der Kinder
- Etwa 50 % stammen aus dem Ortsteil Kalbach-Riedberg.
- Etwa 20 % stammen aus den Ortsteilen Niederursel und Heddernheim.
- Etwa 15 % stammen aus anderen Stadtbezirken.
- Etwa 15 % kommen von außerhalb Frankfurts.
Wo arbeiten (studieren) die Eltern
- Die Goethe Universität unterhält am Campus Riedberg 67 Plätze (von 135 Plätzen) an der Kita Kairos. Weitere 22 Plätze (von 30 Plätzen) unterhält sie in der Kita Zauberberg. Insgesamt also 89 Plätze.
- 33 Plätze der KiTa Kairos ist für Kinder von Mitarbeitern der Max-Planck-Institute (für Hirnforschung und für Biophysik) die am Riedberg angesiedelt sind, vorgesehen.
- Zwischen 13 und 20 Plätze, die eigentlich der Goethe Universität an der Kita Kairos zustehen, werden derzeit von Kindern aus dem Stadtteil genutzt.
Natürliche Belegungsschwankungen
Immer dann, wenn Kinder in die Grundschule wechseln, sinkt vorübergehend die Belegung der Kita. Auch ist nicht jeder Kinder-Jahrgang gleich groß. Verzögert sich der Wechsel an die Schule bei mehreren Kindern, kann es auch zu Überbelegungen oder verlängerten Wartelisten kommen. Zudem hat sich die Arbeitsplatz-Situation noch nicht komplett aus dem Pandemie-Modus erholt: Erst nach und nach arbeiten wieder mehr Leute in Präsenz.

Balancierendes Kind, Foto: Kita Zauberberg
Finanzierung
Die Kita Zauberwald wird von der Stadt nach dem »Modell 100« gefördert. Das heißt, sofern 25% der Plätze mit Stadteilkindern belegt sind, werden alle belegten Plätze zu 100 % von Frankfurt finanziell gefördert (Personalkosten) – und 75 % der Investitionskosten. Im Umkehrschluss heißt das, dass die Goethe Universität neben 25% der Investitionskosten vor allem die laufenden Kosten wie Heizung (Fernwärme), Strom und Wasser tragen muss, denn die Belegungsquote mit Stadteilkindern wurde stets erreicht.
Zielbild der Zusammenlegung
Mit der Schließung der Kita Zauberberg fallen für die Goethe Universität 22 von insgesamt 89 Kitaplätzen weg (25 %). Da bisher 13 bis 20 Plätze an der Kita Kairos an Kinder aus dem Stadtteil vergeben wurden, ließen sich diejenigen der 22 Kinder vom Zauberberg in Kairos integrieren, die nicht in die Schule wechseln. Die Kinder aus dem Stadtteil müssten anderweitig untergebracht werden. Da aufgrund aktueller Belegungsschwankungen sogar nur die Hälfte der universitären Zauberberg-Plätze belegt sind, würde aktuell die Rechnung aufgehen.
Allerdings entfallen zugesagte U3-Plätze für die Stadtteilkinder und auch Geschwisterkinder hätten nur geringe Chancen dort untergebracht zu werden.
Zusage der BVZ
Den Stadtteilkindern der Kita Zauberberg wurde eine bevorzugte Aufnahme in die anderen BVZ-Kitas (FIZ-Kids, Kita Gipfelflitzer, Kita Schatzinsel, Kita Welt-Raum) am Riedberg zugesichert, was im Endeffekt aber wieder andere Stadtteilkinder ihre Plätze kosten wird.
Weitere Aussichten
- Auf Grund der natürlichen Fluktuation und der Erholung nach Ausklang der Pandemie-Situation kann die Nachfrage nach Plätzen auch ganz schnell wieder ansteigen, so dass die dann noch vorhandenen Plätze nicht mehr ausreichen.
- Die Nachfrage nach den Plätzen in den übrig gebliebenen Kitas im Stadtteil wird zunehmen. Dort sind aber auch keine freien Kapazitäten mehr.
- Durch die Fertigstellung der Berghöfe an der Konrad-Zuse-Straße werden zusätzliche Kinder in den Stadtteil kommen. Auch andere Gebäude am Riedberg werden in den nächsten Jahren fertiggestellt und neu bezogen. Im Mertonviertel entsteht auch ein größerer Wohnkomplex auf dem Lurgi-Gelände.
- Neben den 43 Arbeitsgruppen im Bereich Mathematik und Informatik werden im nächsten und übernächsten Jahr etwa 8 neue Arbeitsgruppen in den Fachbereichen Chemie und Biologie an den Campus Riedberg ziehen. Damit wird die Nachfrage nach Kitaplätzen voraussichtlich erheblich ansteigen.
Und wie sieht das die Uni-Leitung?
Der Präsident der Goethe Universität hat in einer Stellungnahme festgehalten, dass der Baufortschritt des Neubaus der Chemie nicht der Grund ist und derzeit nicht die Kita Zauberberg beeinträchtigt, sondern dass die Betreuungskapazitäten für Uni-Kinder in der Kita Kairos ausreichen, um den gesamten Bedarf am Campus zu decken.
Status Exzellenz-Universität
Die Goethe Universität und auch die Max-Planck-Institute sind angehalten, die Chancengleichheit für Nachwuchsforscher und Nachwuchsforscherinnen zu erreichen. Dazu gehören auch Kinderbetreuungskapazitäten. Um als exzellenter Standort ausgewählt zu werden, muss auch dieses Kriterium erfüllt werden. Daher kann es für die Uni und die Max-Planck-Institute zu Nachteilen führen oder zum Verlust von erheblichen Fördergeldern, wenn die Chancengleichheit durch Abbau von Betreuungskapazitäten verringert statt ausgebaut wird.
(ExStra_EXU_Evaluationsleitfaden / DFG Infobrief „Von null auf hundert“)
Die Sicht der Betroffenen
Die Eltern, die Erzieherinnen und natürlich auch die Kinder würden gerne bleiben. Mehrere Forschende der Goethe Universität – sowohl Professoren als auch wissenschaftliche Mitarbeiter – und Führungskräfte der Max-Planck-Institute sind gegen die Schließung, weil die Kapazitäten künftig gebraucht werden und weil Kitaplätze essentiell wichtig für die Anwerbung von Nachwuchsführungskräften in der Forschung sind. Der Ortsbeirat 12 kämpft seit Jahren für den Ausbau von Kitas im Ortsteil Kalbach-Riedberg und angrenzenden Gebieten. Die Bewohner des Ortsteils müssen teilweise ihre berufliche Tätigkeit einschränken, weil keine Kitaplätze für ihre Kinder vorhanden sind.
Der Ortsbeirat 12 (Aktueller Antrag)
bittet den Magistrat, in Abstimmung mit der Goethe-Universität und dem Betreiber der Kita Zauberberg, der BVZ GmbH, zu klären:
- Wie kann die Kita Zauberberg auch für die Kinder des Riedbergs möglichst lange erhalten bleiben? Hierbei soll insbesondere geprüft werden, ob mit einer begrenzten finanziellen Unterstützung der Standort gesichert oder aus Sicht des Riedbergs sogar ausgebaut werden kann.
- Sollte eine Schließung schon zu Mitte 2024 leider doch unabwendbar sein: Welches Ausweichquartier steht für die betroffenen Kinder zur Verfügung und ist dieses sowohl hinsichtlich ausreichend vielen Erzieherinnen und Erziehern als auch von den verfügbaren räumlichen Möglichkeiten her gesichert?
Die BVZ GmbH
betreibt als großer freier und unabhängiger Träger von Kindertageseinrichtungen im Frankfurter Raum knapp 150 Kitas in unterschiedlichen Stadtteilen mit etwa 6.200 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 0-12 Jahren und 2.200 Mitarbeitern. Vor Ort in den Stadtteilen arbeiten sie mit den unterschiedlichsten Institutionen zusammen, sind mit den politischen Gremien und Dachverbänden gut vernetzt, beraten und unterstützen Vereine, die in der Jugendhilfe und Bildungsarbeit tätig sind.
Beim Betrieb und der Leitung betrieblicher Kindertagesstätten können sie auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken und sind höchst professionell aufgestellt. Seit etwa 30 Jahren sind sie in der betrieblichen- und betriebsnahen Kinderbetreuung tätig. Vor allem der Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für sie ein großes Anliegen, dem sie besonders Rechnung tragen. Sie kooperieren mit großen Konzernen aus den unterschiedlichsten Branchen, aber ebenso mit großen staatlichen und privaten Bildungs- und Gesundheitsinstituten.
(https://www.bvz-frankfurt.info/wer-wir-sind/)
Modell 100
Die Stadt Frankfurt fördert alle belegten Plätze und gewährleistet ihre Finanzierung unter Anrechnung von Drittmitteln (insbesondere Eltern-Entgelte und Landeszuwendungen) in Höhe von 100 % der zuwendungsfähigen Kosten, wenn mindestens 25 % der Plätze von Frankfurter Kindern von Nicht-Betriebsangehörigen belegt werden können. Die Regelöffnungsdauer beträgt 47,5 Wochenstunden.
Die Stadt Frankfurt beteiligt sich mit einer Investitionsförderung (bis zur Höhe von 75 % der jeweils geltenden Sofortprogrammförderung ab einer Belegung von 25 % der Plätze mit Nicht-Betriebsangehörigen Frankfurter Kindern).
Für die Erhebung von Eltern-Entgelten gilt die Orientierung an den städtischen Regelungen.
(https://frankfurt.de/themen/arbeit-bildung-und-wissenschaft/bildung/kindertagesbetreuung/betriebliche-kindertageseinrichtungen)