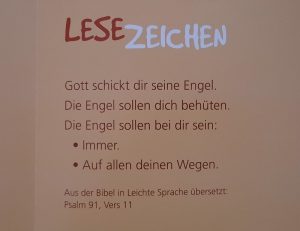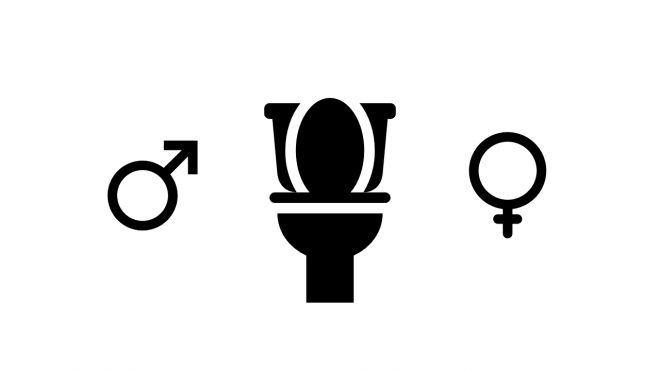Die Deutsche Blindenstudienanstalt (blista) in Marburg hat zum Welt-Braille-Tag eine innovative Anwendung vorgestellt, die das Erlernen der Blindenschrift revolutionieren soll. Mit der App „Braille-Trainer“ wird der Zugang zur taktilen Schrift von Louis Braille für blinde und sehende Menschen gleichermaßen erleichtert.
Anlässlich des Welt-Braille-Tags am 4. Januar, der an den Geburtstag des Erfinders Louis Braille erinnert, präsentierte die »blista« in Marburg ein besonderes digitales Angebot. Vor über 200 Jahren erfand der damals 16-jährige Franzose das System aus 6 tastbaren Punkten, das blinden Menschen bis heute den Zugang zu Bildung und Literatur ermöglicht. Die neue App „Braille-Trainer“ soll diese bewährte Methode nun in das digitale Zeitalter überführen.
Unterstützung für inklusives Lernen
Ein zentrales Ziel der App ist es, nicht nur blinde Menschen beim Erlernen der Schrift zu unterstützen, sondern auch sehende Eltern und Lehrer einzubeziehen. Die Anwendung fungiert als Brücke: Sie ermöglicht es sehenden Bezugspersonen, blinden Kindern effektiver beim Erlernen der Brailleschrift zu helfen. Patrick Temmesfeld, Vorstand der »blista«, betont, dass die App einen modernen und einfachen Zugang zur Blindenschrift bieten soll.
Von der Vollschrift zur Kurzschrift
In der schulischen Ausbildung erlernen blinde Kinder meist zunächst die sogenannte Vollschrift. Um jedoch ein hohes Lese- und Schreibtempo zu erreichen, ist die Beherrschung der Kurzschrift unerlässlich. Laut Rudi Ullrich, Koordinator der »blista«-Kampagne „Knack den Code“, wurde diese Form der Schrift in der Vergangenheit oft vernachlässigt. Die App bietet hier als „zeitgemäßes Medium“ Abhilfe und führt die Nutzer durch verschiedene Lektionen. Dabei kann die Anwendung sowohl gedruckte Schrift in Braille als auch Blindenschrift zurück in gedruckte Buchstaben übersetzen.
Entstehungsgeschichte und Engagement
Die Wurzeln des Projekts liegen in einer privaten Initiative: Der Hamburger Programmierer Martin Gertz begann vor Jahren in seiner Freizeit mit der Entwicklung, um einem befreundeten Paar – einer sehenden und einer blinden Person – den gegenseitigen Nachrichtenaustausch zu ermöglichen. In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Bildung und Barrierefreiheit der »blista« wurde die Anwendung kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert.
Die App ist zudem Teil der Aufklärungskampagne „Knack den Code“, die sich für eine inklusive Gesellschaft einsetzt. Als Botschafter fungiert dabei der blinde Waschbär Louis, der in Kurzgeschichten zeigt, wie er seinen Alltag meistert. Diese Geschichten sind in Brailleschrift verfasst und können von den Nutzern mithilfe eines Alphabets entschlüsselt werden.
Verfügbarkeit und Förderung
Zum Start stellt die »blista« die ersten 1.000 Downloads der App kostenlos zur Verfügung. Langfristig hofft die Studienanstalt, das Angebot durch Spenden dauerhaft kostenfrei für alle Nutzer anbieten zu können. Der „Braille-Trainer“ steht ab sofort im Apple AppStore sowie im Google PlayStore zum Herunterladen bereit.
Blindenschrift am Riedberg
Das Riedbergzentrum besitzt ein markantes Kunst-am-Bau-Element: ein 460 Meter langes und 1,50 Meter hohes Fassadenband in Blindenschrift (Braille), die Texte von Thomas von Aquin in erhabenen Punkten darstellt, um die Wahrnehmung der Welt zu thematisieren und die architektonischen Elemente visuell zu ergänzen. Es gibt also eine sichtbare, taktile Anwendung von Blindenschrift direkt an der Architektur des Zentrums, die über reine Funktionalität hinausgeht.
Für das Zentrum des neuen Frankfurter Stadtteils Riedberg entwickelte der Frankfurter Künstler Klaus Schneider ein Fassadenband, das den vierteiligen Gebäudekomplex verbindend umschließt. Metallfolien auf glänzend lackierten Aluminiumplatten zeigen einen in Braille-Schrift gestalteten Text frei nach Thomas von Aquin, der sich mit der menschlichen Wahrnehmung der Welt und seiner daraus resultierenden Wesensform beschäftigt. Die Kreisformen des Blindenschriftrasters spielen mit den strengen, kubischen Elementen der modernen Architektur.

Text auf dem Fassadenband
Erkennende Wesen
„Erkennende Wesen unterscheiden sich von nicht erkennenden darin, dass die nicht erkennenden nichts haben als nur ihre eigene Wesensform. Das erkennende Wesen aber ist darauf angelegt, die Wesensform auch des anderen zu haben. Das Bild des Erkannten ist im Erkennenden und bei der Erkenntnis spielt das Geschlecht keine Rolle!“
Weiterführende Links
- https://kobinet-nachrichten.org/2025/05/06/startschuss-fuer-bundesweite-aufklaerungskampagne-zur-brailleschrift-an-schulen/
- http://klausschneider-atelier.de/126-0-RiedbergZentrum.htm
- Apple AppStore
- Google PlayStore