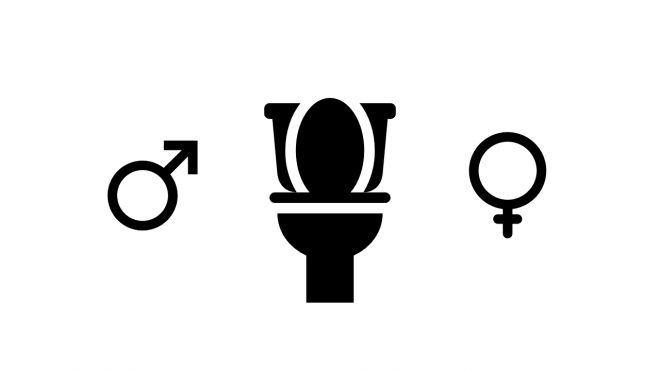Bereits 2016 lief eine Inklusionslaufgruppe in Kooperation mit den Special Olympics Hessen beim Zipfelmützenlauf des SC Riedbergs mit. Der Tag der Inklusion am 24.02.2024 war wieder ein voller Erfolg. Alle Beteiligten hatten einen enormen Spaß bei den sportlichen Aktivitäten.
Seit Längerem beschäftigt den Verein das Thema Inklusion am Riedberg, vor allem unter einer Leitfrage: Wie kann der Verein SC Riedberg unterstützend tätig sein, damit auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung am Vereinssport teilnehmen können?
Dazu hat Frau Nele Kämpf Kontakt mit Mitarbeitern von Special Olympics aufgenommen und nach mehreren gemeinsamen Arbeitstreffen einen Zukunfts-Plan ausgearbeitet.
Den Verantwortlichen im Verein geht es darum, ein Angebot für alle Menschen auf und um den Riedberg herum anzubieten. Menschen mit geistiger Beeinträchtigung haben oft nicht die Option Sport im Rahmen eines Vereins auszuüben und genau das soll sich ändern. Daher wäre das Konzept des „Unified Sports“ (gemeinschaftliches Handeln im Sport = gelebte Inklusion) ein Modell, das die Vereinsmitglieder zukünftig gerne gemeinsam umsetzen würden.
Daher ist der Verein noch auf der Suche nach Mitgliedern oder anderen Unterstützern, die schon Erfahrung im Umgang mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung haben, und bereit sind, den Verein bei der Umsetzung zu unterstützen und zu beraten. Auch für weitere Anregungen, Ideen und Feedback ist der Verein immer dankbar.
Die aktuelle Ansprechpartnerin für Inklusion im Sport ist die zweite Vorsitzende, Frau Nele Kämpf (eMail: 2.vorsitzende@scriedberg.de).
Wichtige Terminankündigungen des SC Riedberg e. V.
- Fußballturnier Jugend: 17.-19.05.2024
- EM Public Viewing: 14.06.-14.07.2024
- Sommerfest: 07.09.2024
- Oktoberfest: 05.10.-06.10.2024